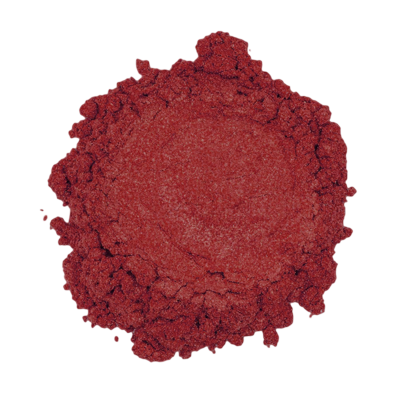Echoes of Belonging
Echoes of Belonging
Musiktheater, Chor und Community im transnationalen Raum
von Elia Rediger
Ich schreibe immer versuchend zu verstehen, warum Menschen überhaupt zusammenkommen, warum sie singen, warum sie tanzen, warum sie schweigen, und warum sie trotz aller Zumutungen der Welt immer wieder bereit sind, ihren Atem zu teilen und ein gemeinsames „Wir“ zu riskieren, auch wenn niemand weiß, ob dieses Wir hält oder ob es im nächsten Moment wieder zerfällt.
Ich bin im Kongo geboren und in der Schweiz aufgewachsen, zwei Orte, die für mich nicht nur geographische Koordinaten sind, sondern Klangräume, Erinnerungsspeicher, Resonanzflächen, und irgendwie auch geistige Heimatländer. Ich habe früh gespürt, dass Zugehörigkeit kein Besitz ist, kein Ausweis, kein Pass, sondern eher eine Schwingung, ein Moment, in dem man nicht mehr ganz allein klingt. Und deshalb arbeite ich heute mit Chören, mit Oper, mit Ritualen, mit Rock’n’Roll, mit Community – weil ich glaube, dass man dort am ehrlichsten erlebt, wie fragil und zugleich wie stark menschliche Verbundenheit sein kann.
Dieser Text ist kein wissenschaftlicher Aufsatz. Er ist eher ein persönlicher Versuch, in Worte zu fassen, warum mich das Chorische nicht mehr loslässt. Vielleicht ist er ein Echo. Vielleicht auch ein Ruf.
Drei frühe Bilder vom Chor
1. Der Kreis im Dorf
Ich beginne oft mit diesem Bild: Njanga, ein kleines Dorf im Kongo. Mein Vater wird von einer grünen Mamba gebissen. Man trägt ihn auf einem Fahrrad zum Dorfplatz. Meine Mutter steht mit uns Kindern in einem Kreis um ihn herum. Es wird gebetet, geflüstert, geweint, gehofft. Ich weiß, dass ein Teil dieser Erinnerung aus Erzählungen besteht, weil ich zu klein war, um wirklich zu begreifen, was geschah, aber trotzdem ist dieses Bild tief in mir eingeschrieben: eine Gemeinschaft, die sich wortlos um einen gefährdeten Körper versammelt, als wäre die gemeinsame Präsenz selbst schon eine Art Lied.
Ich glaube, hier beginnt meine Idee vom Chor.
2. Der Irrtum am Bahnhof
Ein paar Jahre später stehe ich als Kind in der Schweiz an einem Bahnhof. Kinderchor. Wir sollen Christoph Schlingensief empfangen. Roter Teppich. Große Aufregung. Nur leider stehen wir an der falschen Tür. Alles gerät durcheinander. Und plötzlich winkt uns dieser Mann von irgendwoher zu, als wüsste er genau, dass im Irrtum eine zarte Form von Wahrheit liegt.
Damals habe ich begriffen:
Ein Chor darf sich irren.
Und vielleicht muss er es sogar.
3. Wer singt – und wer schweigt?
In der Sonntagsschule sitze ich später zwischen betenden Stimmen und frage mich plötzlich, wer eigentlich nicht mitspricht. Wer fehlt? Wer schweigt? Und warum?
Vielleicht beginnt hier meine Faszination für die Leerstelle im Chor. Für die stille Stimme. Für das Nicht-Singen.
Wer singt im Chor? Und warum arbeite ich damit?
Für mich ist der Chor kein ästhetisches Ideal, kein Ornament, kein harmonisches Postkartenmotiv. Er ist ein sozialer Körper. Ein Versuchsfeld aus Macht, Nähe, Missverständnis, Fürsorge und Irrtum. Heiner Goebbels spricht vom Musiktheater, das beginnt zu denken, statt nur zu schmücken – und genau das interessiert mich: der Chor als Denkform. Als Ort, an dem Stimmen sich überlagern, widersprechen, einander tragen und trotzdem eine fragile Einheit bilden.
Ich arbeite mit Chören, weil sie mich zwingen, mich selbst zu relativieren. Ich bin dort immer nur eine Stimme unter vielen. Und ich merke, wie sehr ich dieses Gefühl brauche.
Gemeinschaft als Klang – Resonanz als Erfahrung
Ich glaube nicht, dass Gemeinschaft durch Gleichheit entsteht. Für mich ist sie eine Art Schwingung. Ein zartes „Zwischen uns“. Hartmut Rosa nennt das Resonanz, und ich fühle mich darin sehr verstanden: Subjekt und Welt berühren sich – und beide verändern sich.
Vielleicht bin ich deshalb so gerne unterwegs zwischen Oper, Rave, Kirche und Aktivismus. Weil ich dort immer wieder erlebe, wie ein Raum kippt, wie Menschen plötzlich gemeinsam atmen, wie aus Einzelnen für einen Moment ein Wir wird, das niemand besitzt, aber alle gemeinsam tragen.
Jean-Luc Nancy sagt:
„Das Wir ist ein Schwingungsraum.“
Ich glaube, mein ganzes Arbeiten ist ein Versuch, diesen Raum zu öffnen.
Der Opernchor – ein Spiegel der Gesellschaft
Natürlich lässt sich an Opernchören europäische Geschichte ablesen. Verdi. Wagner. Nationale Klangkörper. Ideologie. Pathos. Und doch interessiert mich am meisten der Moment, in dem der Chor scheitert, stolpert, sich verirrt. René Pollesch sagte einmal: „Ein Chor irrt sich gewaltig.“ Ich empfinde das beinahe zärtlich.
Denn ich glaube, Zugehörigkeit entsteht nicht durch Perfektion, sondern dadurch, dass wir gemeinsam Unsicherheit aushalten. Dass wir uns erlauben, nicht zu funktionieren.
Vielleicht ist das mein eigentliches Thema.
Erinnerungen, Echos, Stimmen – Hercule de Lubumbashi
Wenn ich zwischen Lubumbashi, Leipzig, Wien oder Portland arbeite, spüre ich immer wieder die Kraft kollektiver Erinnerung. In „Hercule de Lubumbashi“, einem Minen-Oratorium mit ehemaligen Arbeiter:innen, Aktivist:innen und Musiker:innen, wurde der Chor zu einem singenden Archiv. Keine Fiktion. Kein erfundenes Libretto. Nur Stimmen, die nicht verstummen wollten.
Ich habe dort verstanden, dass ein Chor nicht nur Klang produziert, sondern Geschichte – und dass das Echo keine Wiederholung ist, sondern Antwort.
Institution und Irritation
An Opernhäusern höre ich manchmal: „Den Chor kriegen wir nicht.“ Und ich denke dann still: Vielleicht ist genau das gut so. Denn dort, wo alles reibungslos funktioniert, verschwindet das Riskante. Ich glaube, Theater beginnt da, wo jemand den Mund öffnet – und jemand anders antwortet. Nicht dort, wo Management-Prozesse beginnen.
Vielleicht suche ich deshalb in meiner Arbeit immer wieder nach der Störung. Nach dem Moment, in dem etwas wackelt.
Warum kommen Menschen zusammen?
Ich glaube, Menschen kommen zusammen, weil sie spüren, dass sie allein nicht vollständig hören. Die Oper ordnet Gefühle. Der Rave synchronisiert Körper. Die Kirche versöhnt uns mit unserer Zerbrechlichkeit. Überall entsteht kurz dieses fragile Wir.
Zugehörigkeit ist für mich kein Zustand.
Sie ist ein Vorgang des Hörens.
Caravan of LUV – mein rollender Chor
Mit Caravan of LUV wollte ich sehen, was passiert, wenn wir die Bühne abschaffen. Wenn der Chor auf Rädern fährt. Wenn Rock’n’Roll auf Ritual trifft. Wenn ein Bus, eine Band und ein Publikum sich gegenseitig in Bewegung versetzen.
Ich merke dabei immer wieder: Menschen singen nicht mit, weil sie den Text kennen. Sondern weil sie sich erkannt fühlen.
Und deshalb lade ich euch ein:
4. November – Oper Leipzig.
Kommt. Atmet. Singt. Oder bleibt still. Alles gehört dazu.
Echoes of Belonging – was bleibt?
Ich verstehe Musiktheater immer stärker als Zeremonie des Zusammenkommens. Ich arbeite an Opern, die nicht repräsentieren wollen, sondern Resonanzräume öffnen. Zwischen Europa und Kongo. Zwischen Geschichte und Gegenwart. Zwischen Klang und Stille.
Und ich glaube, das Publikum ist längst Teil des Chors, ob es sich so fühlt oder nicht. Die wirklich spannende Frage ist für mich:
Wer hört – und warum?
Vielleicht, weil Zuhören manchmal die radikalste Form des Sprechens ist. Und vielleicht liebe ich deshalb diese Arbeit so sehr.
Nachbemerkung
Dieser Text entstand im Rahmen des Opernsalons
„Echoes of Belonging – Musiktheater, Chor und Community im transnationalen Raum“
am 29. Oktober 2025
am Institut für Theaterwissenschaft der Universität Leipzig.